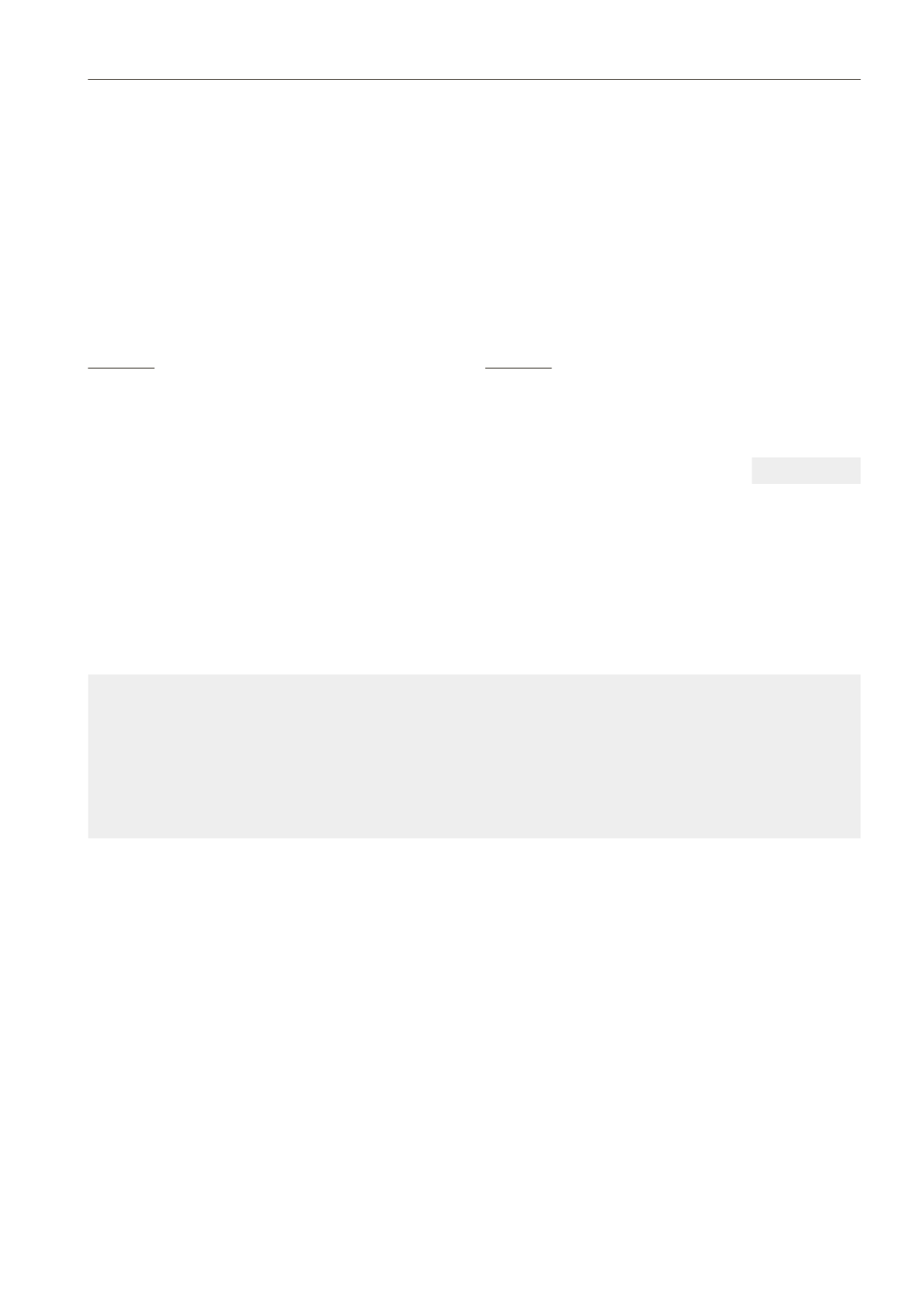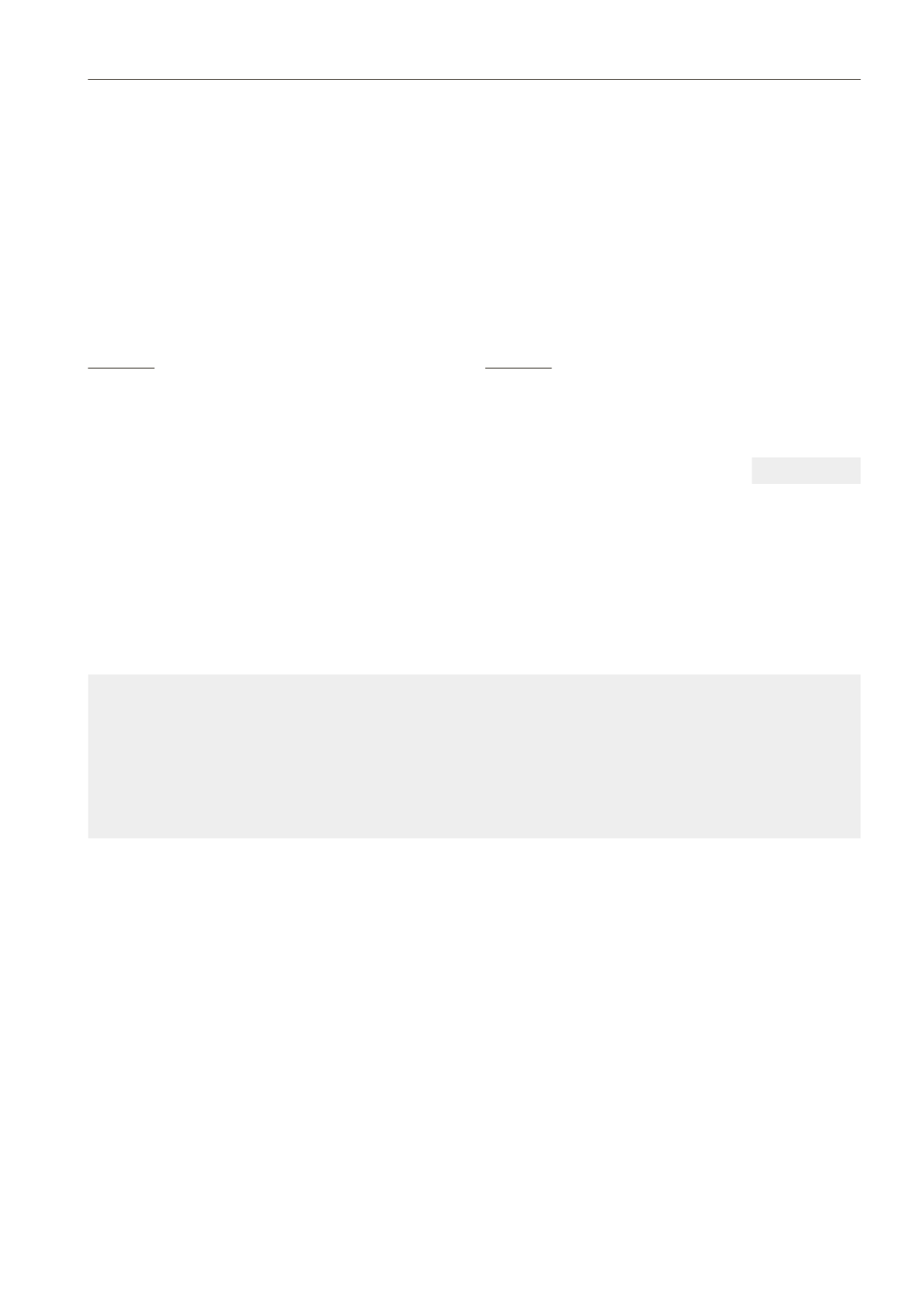
ten ist, dass gut vorbereitete Anfragen, die bereits einen Lö-
sungsvorschlag mitliefern, schneller und umfassender bear-
beitet werden.
17
Speziell bei Versorgungsunternehmen nehmen mit Blick auf
die zunehmende digitale Datenflut die potentiellen Gefahren
zu. Hochsensible Mitarbeiter-, Kunden- und Geschäftsdaten,
insbesondere Steuerungs- und Prozessdaten, sind vor Mani-
pulation und Missbrauch zu schützen. Eine nicht korrekte
oder umfassende Umsetzung der neuen Bestimmungen kann
das Vertrauen in das Unternehmen nachhaltig negativ beein-
flussen. Wichtig ist dennoch, den Datenschutz nicht als
»Schreckgespenst« zu begreifen, welches in der Umsetzung
Prozesse lahmlegt. Bei der Berücksichtigung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen lassen sich insbesondere für Ver-
sorgungsunternehmen, die als Betreiber kritischer Infrastruk-
turen wie z. B. Energieversorgungsnetzen den IT-Sicherheits-
katalog der Bundesnetzagentur für Netze umsetzen und ein
den Anforderungen entsprechendes Informationssicherheits-
managementsystem einführen und zertifizieren lassen müs-
sen, Synergien heben.
Der mit der Einhaltung datenschutzrechtlicher Regeln ver-
bundene Vertrauensgewinn kann für Unternehmen große
Vorteile mit sich bringen – im Zuge der Umsetzung werden
sich neben der Optimierung vorhandener Prozesse eine Stei-
gerung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit einstellen.
Daten gelten als das »Öl« bzw. »Gold« des 21. Jahrhun-
derts.
18
Wer nachweislich hohe datenschutzrechtliche Stan-
dards vorhält, dem werden Daten regelmäßig weitaus bereit-
williger übermittelt.
10
VERSORGUNGSWIRTSCHAFT
HEFT 1 2018
17
Nils Schröder, Leiter Referat Grundsatzfragen & Pressesprecher des LDSB
NRW in Unternehmensjurist 03/2016.
18
Siehe u. a. Zeit Online 10.03.2015, Ein Gespräch über das Schürfen von
Daten im Internet mit Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender der Datev.
1. Einleitung
Juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) gehen
vielen wirtschaftlichen Aktivitäten nach, deren Jahresergeb-
nisse nur unter bestimmten Voraussetzungen zusammenge-
rechnet und saldiert werden dürfen. § 4 Abs. 6 KStG lässt den
Querverbund zu, wenn die Betriebe gewerblicher Art (BgA)
gleichartig sind, zwischen ihnen nach dem Gesamtbild der
tatsächlichen Verhältnisse objektiv eine enge wechselseitige
technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht
besteht oder es sich um Betriebe handelt, die der Versorgung
der Bevölkerung mit Wasser, Gas, Elektrizität oder Wärme,
dem öffentlichen Verkehr oder dem Hafenbetrieb dienen.
Fügt die öffentliche Hand ihre unternehmerischen Betätigun-
gen in einer Kapitalgesellschaft zusammen, ist ein Verlust-
ausgleich zwischen den einzelnen Sparten im Rahmen des
§ 8 Abs. 9 KStG zulässig.
Daneben kommt eine steuerwirksame Verlustverrechnung
durch die Begründung eines Organschaftsverhältnisses in
Betracht. Die Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer Organ-
schaft werden nachfolgend skizziert. Ein weiterer Abschnitt
widmet sich den umsatzsteuerlichen Leistungsbeziehungen
zwischen dem Organträger und der Organgesellschaft.
2. Ertragssteuerliche Organschaft
Seit dem Jahr 2003 setzt eine Organschaft im Körperschaft-
steuerrecht einerseits und im Gewerbesteuerrecht anderer-
seits eine
finanzielle Eingliederung
sowie einen
Ergebnisab-
führungsvertrag i.S.d. § 291 AktG
voraus. Die Voraussetzun-
gen für das Vorliegen einer Organschaft im Gewerbesteuer-
recht stimmen seitdem mit denen der körperschaftsteuerli-
chen Organschaft überein. Bei AG und KGaA greift unmittel-
bar § 14 KStG, bei anderen Gesellschaften – insbesondere die
GmbH – als Organgesellschaft kommt die Vorschrift über
§ 17 KStG zur Anwendung. Gewerbesteuerlich ist die Organ-
schaft in § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG kodifiziert. Die Organge-
sellschaft gilt demnach als Betriebsstätte des Organträgers.
Es wird kein einheitliches Unternehmen begründet; stattdes-
sen wird der Gewerbeertrag für jedes Unternehmen getrennt
unter Berücksichtigung der Hinzurechnungen und Kürzun-
gen (§§ 8 und 9 GewStG) ermittelt.
Betriebe gewerblicher Art als Organträger
– von Dipl.-Bw.(FH)/Dipl.-Vw./Dipl.-Hdl. Martin Kronawitter, Untergriesbach –
Kommunen schon von mittlerer Größe betätigen sich in vielfältiger Weise wirtschaftlich. Sie verfügen häufig über ein
Geflecht von Betrieben gewerblicher Art, (haftungsbeschränkten) Personen- und Kapitalgesellschaften. Der steuer-
lichen Ergebnisverrechnung innerhalb des Konzerns Kommune sind dabei Grenzen gesetzt. Mit Hilfe einer Organ-
schaft lassen sich jedoch die gesellschaftsrechtlichen Strukturen aufbrechen und – ertragsteuerlich – Gewinne und Ver-
luste einander verrechnen. Aus umsatzsteuerlicher Perspektive können Belastungen vermieden werden, indem die
Leistungsbeziehungen innerhalb des Organkreises als nicht steuerbare Innenumsätze deklariert werden. In diesem
Beitrag sind die Voraussetzungen sowohl einer ertragsteuerlichen als auch einer umsatzsteuerlichen Organschaft, spe-
ziell bei Betrieben gewerblicher Art als Organträger, zu thematisieren.
DokNr. 18004526